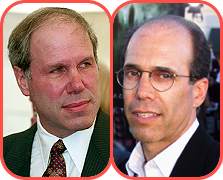Im neunten
Kapitel von „DisneyWar“ wird nun deutlich, wie sehr Eisner von diesem eigenen
Machterhalt besessen war, und dass er dafür über Leichen ging – oder in diesem
Fall: über Freundschaften, hier mit Michael Ovitz. Noch vor dessen Ernennung
zum Präsidenten rebellierten zwei Führungskräfte, die eigentlich Ovitz
unterstellt sein sollten: Steve Bollenbach, Leiter der Finanzabteilung, und Sandy
Litvack, Leiter der Rechtsabteilung. Beide Bereiche waren bisher den
Präsidenten (also Wells) unterstellt gewesen, nun wollten sie allerdings Eisner
unterstellt sein – und drückten dies gegenüber Ovitz deutlich aus: „Ich will
Ihnen nur sagen, dass ich niemals für Sie arbeiten werde“, wird Bollenbach
gegenüber Ovitz zitiert (S. 327).
| Michael Ovitz |
Für Ovitz sei
damals das Schlimmste gewesen, dass Eisner ihn gegen diese Rebellion nicht
unterstützt habe: Für ihn sei seine Management-Autorität bereits vor dem ersten
Arbeitstag untergraben worden, was sich später noch als folgenreich
herausstellen sollte: Auch Peter Schneider und seine Trickfilmabteilung wollten
bald nicht mehr für Ovitz arbeiten (dies beschloss Roy Disney), außerdem
berichteten Führungskräfte permanent über die vermeintlichen Fehler von Ovitz.
Dieser wusste noch vor seiner Wahl zum Präsidenten, „dass ihn sein bester
Freund [Eisner] verraten hatte“ (S. 328), indem dieser nicht voll hinter seinem
neuen Partner stand. Ohnehin hatte Eisner informell ausgehandelt, dass Ovitz
kein gleichberechtigter Partner neben ihm sein würde, sondern nur die offizielle
Nummer 2. Doch schnell stellte sich heraus, dass er nicht einmal dies war:
Abgesehen davon, dass ihm mehrere Abteilungen – anders als ursprünglich
vereinbart – gar nicht unterstellt waren, kämpfte Ovitz jeden Tag um seinen
Rang. Die Tatsache, dass er nur im fünften Stock des Disney-Hauptgebäudes in
einem kleinen Büro untergebracht wurde, und damit einen Stock niedriger als Studioboss
Joe Roth und Eisner, verdeutlichte seine Stellung sinnbildlich. Eine Diskussion
über eine verbindende Treppe zwischen den Stockwerken zwecks besserer
Kommunikation verneinte Eisner, er habe „das Gebäude absichtlich so gestaltet,
dass man an sein Büro nicht so leicht herankam.“ (S. 331). Diese Stelle liest
sich fast kafkaesk, so skurril und realitätsfremd wirkt sie.
Auch wenn im
Buch davon nicht die Rede ist: Ovitz wirkt nicht nur wie eine Marionette – so
hatte es Eisner ja ursprünglich beabsichtigt –, sondern in der Anfangszeit wie
eine Marionette ohne Fäden. Eisner brauchte ihn zunächst nicht, und Wochen nach
Ovitz‘ Ernennung als Präsident im September 1995 schreibt auch James Stewart in
„DisneyWar“: „Es war immer noch unklar, wofür Ovitz genau zuständig war […].“
(S. 342). Als Marionette ohne Fäden war es Ovitz in keinster Weise möglich,
eigene Ideen einzubringen oder Geschäfte abzuwickeln. Als Vermittler und
Netzwerkler war Ovitz brillant darin, höchst profitable Deals für seine
Klienten abzuwickeln, dafür wurde er einst als „mächtigster Mann Hollywoods“
bezeichnet. Bis zum Antritt bei Disney hatte er eine Abschlussquote von 100
Prozent bei seinen Deals – nun sank sie gen Null: Es wurde eine Partnerschaft
mit Brad Grey verweigert, der über 150 Künstler repräsentierte, darunter Brad
Pitt und Jennifer Aniston; eine Party mit zahlreichen Kreativen der Branche
(darunter Steven Spielberg und Tom Hanks), um Beziehungen aufzubauen, machte
Eisner wütend; die Übernahme des Verlags Putnam (u.a. Tom Clancy, John Grisham,
Michael Crichton) verweigerte Eisner ebenso wie einen Deal mit der damals
erfolgreichsten Sängerin der Welt, Janet Jackson. Bei den meisten solcher
gescheiterten Geschäfte stellte sich später heraus, dass Ovitz einen
hervorragenden Preis ausgehandelt hatte: Janet Jackson beispielsweise hätte bei
Disney 75 Millionen US-Dollar für sieben Alben bekommen, nach dem geplatzten
Deal unterschrieb sie bei Virgin einen Vertrag über 80 Millionen, aber nur für
vier Alben.
Weitere
gescheiterte Geschäfte in dieser Zeit betrafen eine Fusion des
Disney-Musiklabels mit Sony, den Aufbau eines Downtown Disney mitten in Los
Angeles, den Verkauf des defizitären Zeitungsbereichs und den Kauf der
Plattenfirma EMI. Möglich, dass einige dieser Punkte nicht sinnvoll gewesen
sein mögen – dass aber kein einziges von Ovitz initiiertes Projekt zum
Abschluss gebracht wurde, weil Eisner und andere ständig ein Veto einlegten,
verdeutlicht die Machtlosigkeit dieses neuen Präsidenten. Eisner wusste dessen
kaum zu schätzen und warnte Ovitz: „Der Deal ist bei Disney nicht das
Wesentliche. […] Der Betrieb an sich ist wichtig.“ (S. 340).
| Eisner und Ovitz |
Irgendwelche
Aufgaben aber musste Eisners neuer Untergebener haben: Bald waren es die, die
dem Disney-Boss selbst zu unangenehm waren. Von der Marionette wandelte sich
Michael Ovitz zum Feuerwehrmann, der Eisners Brände löschen musste. Er sollte
die Trickfilm-Abteilung auf Trab halten, da Jeffrey Katzenbergs neues Studio
Dreamworks viele Talente anheuern wollte – durch Ovitz, der unter anderem
Vernissagen für die Zeichner veranstaltete, blieben viele Köpfe bei Disney,
auch dank gestiegener Bezüge. Unter anderem schaffte es Katzenberg nicht,
Andreas Deja, Glen Keane sowie das Duo Ron Clements und John Musker abzuwerben.
Auch bei Tim Allen bewies Ovitz Geschick: Nachdem er wutentbrannt das Set von
"Hör mal, wer da hämmert" verlassen hatte, ließ er Allen ein teures Geschenk
zukommen – die Arbeit am Set verlief von da an ruhig.
Die Methoden
von Ovitz mögen unkonventionell gewesen sein – Sandy Litvack beschwerte sich
sogar darüber, dass Ovitz nicht wisse, wie man in einer Aktiengesellschaft
arbeitet. Aber zweifelsohne konnte der Präsident die meisten Brände löschen,
die im Unternehmen loderten. Aber nicht alle: Noch immer schwelte der Streit
über Katzenbergs Bezüge, die er nach Verlassen des Unternehmens nicht bekommen
hatte und die ihm angeblich zustünden. Ein Zeitungsartikel, in dem Katzenbergs
Anwalt einige Dinge nach außen trag, goss zudem Öl ins Feuer. Ovitz glaubte den
Streit mit seinem Verhandlungsgeschick lösen zu können – doch abermals stellte
sich Eisner quer. Nachdem Ovitz unter Eisners Zustimmung eine (seiner Meinung
nach günstige) gütliche Einigung über die Zahlung von 90 Millionen US-Dollar
ausgehandelt hatte, änderte der CEO seine Meinung und erklärte, dass Katzenberg
gar nichts zustehe. Ovitz sagte, dass sie später vermutlich deutlich mehr
zahlen müssten, wenn sie jetzt nicht auf den Deal eingehen, doch Eisner und Finanzchef
Litvack blieben stumm. (Ovitz sollte Recht behalten).
| Bob Iger |
Eine weitere
Aufgabe, die Eisner Ovitz übergab, war jene des Austauschs einiger
Führungskräfte. Unter anderem wollte Eisner den Studiochef Joe Roth ersetzen –
und, wie bereits zuvor angeklungen war, Bob Iger. Dieser führte damals die
übernommene TV-Sparte um ABC erfolgreich; einen triftigen Grund, Iger
hinauszuwerfen, gab es nach wie vor nicht. Auch Iger selbst merkte, dass er
kurz vor dem Rauswurf stand und überlegte, selbst zu kündigen. Und Ovitz war in
diesem Herbst 1995 derjenige, der Iger dazu bewegen konnte, zu bleiben: Ovitz
überzeugte nicht nur ihn, sondern auch Eisner, der Iger eigentlich „nicht für
den richtigen Geschäftsführer [hielt]“ (S. 349). Aus heutiger Sicht ist wohl
das der größte Verdients in der sehr kurzen Amtszeit von Michael Ovitz: dass er
den heutigen CEO Bob Iger damals im Unternehmen halten konnte, trotz deutlicher
Unstimmigkeiten zwischen Iger und Eisner, und trotz des Bestreben Eisners, ihm
hinauszuwerfen.
Zusammenfassend
lässt sich erkennen, dass das große Problem von Michael Ovitz die Unterstützung
war: Ihm fehlte sie nicht nur von Michael Eisner, sondern auch von anderen
angeblich Ovitz unterstellten Abteilungen. Der Präsident war von Anfang an im
Unternehmen isoliert und wirkte wie eine Art Repräsentant von Disney, der
schlichten und beschwichtigen sollte. Als starker Manager hätte er – seinen
guten Referenzen und seinen interessanten Ideen zufolge – Eisner wirklich
helfen können, aber auch hier zeichnet „DisneyWar“ wieder das egozentrische,
destruktive Bild eines Disney-Chefs, der kaum Kompetenzen abgeben will und das
Unternehmen als sein eigenes Imperium betrachtet – oder, wie die Washington
Post später schrieb: Er ist der Machiavelli im Magic Kingdom.
Im nächsten Teil des Lesetagebuchs geht es um das spektakuläre Zerwürfnis zwischen Eisner und Ovitz, das große mediale Aufmerksamkeit erlangen sollte und den Konzern angeschlagen zurückließ.